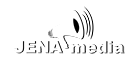Wie Mikroben Methanemissionen aus Grundwasser eindämmen
Methan ist eines der wirksamsten Treibhausgase der Erde – und spielt eine entscheidende Rolle im globalen Klimageschehen. Seine Wärmespeicherfähigkeit ist kurzfristig 84-mal höher als die von Kohlendioxid. Daher gilt die Reduktion von Methanemissionen als besonders wirksame Maßnahme gegen die globale Erwärmung. Doch wie viel Methan aus dem Grundwasser tatsächlich in die Atmosphäre gelangt, war bislang unklar.
Ein Forschungsteam des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie und der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat nun eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Mikroben im Grundwasser wirken als natürlicher Methanfilter und können mehr als die Hälfte des vorhandenen Methans abbauen, bevor es entweicht. Die Ergebnisse dieser Studie wurden kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift PNAS veröffentlicht.
Jena-Media Veranstaltungstipp:
Dirk Zöllner & Julian Wolf 2026 live in Jena: „Betreutes Musizieren“ im M-Pire Musik Club

Mikroben als natürliche Klimaschützer
Grundwasser kann Methan aus verschiedenen Quellen enthalten – sowohl aus mikrobieller Aktivität als auch aus fossilen Ablagerungen. In hohen Konzentrationen kann dieses Gas die Trinkwasserqualität beeinträchtigen oder in Böden und Gewässer gelangen, wo es in die Atmosphäre übertritt.
Die neue Studie zeigt jedoch: Mikroorganismen im Grundwasser oxidieren einen großen Teil des Methans, bevor es an die Oberfläche gelangt. Damit tragen sie wesentlich dazu bei, den Methanhaushalt der Erde im Gleichgewicht zu halten.
„Unsere Ergebnisse belegen, dass ein hochaktiver mikrobieller Methanfilter im Grundwasser eine entscheidende Rolle bei der Begrenzung von Methanemissionen spielt“, erklärt Beatrix M. Heinze, Doktorandin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena.
Hochsensible Messmethoden ermöglichen neue Erkenntnisse
Für die Studie nutzten die Forschenden eine verfeinerte Radiokohlenstoff-Tracermethode, um die Methanoxidation in verschiedenen Grundwässern genau zu bestimmen. Untersucht wurden dabei Aquifere aus Karbonat- und Sandsteinformationen in Mittel- und Norddeutschland.
Die Konzentrationen des Methans variierten erheblich – von kaum messbar bis zu übersättigt. In allen Fällen zeigte sich: Je höher die Methankonzentration, desto aktiver waren die Mikroben beim Abbau.
„Unsere Methode erlaubte es uns, nicht nur den Methanabbau zu messen, sondern auch herauszufinden, wie viel Methan die Mikroben für ihre Energiegewinnung und ihr Wachstum nutzen“, erläutert Heinze. Dabei wurde deutlich, dass die Mikroben das Gas hauptsächlich zur Energieerzeugung verwenden – und weniger, um neue Biomasse aufzubauen.
Forschung mit internationaler Zusammenarbeit
Zur Weiterentwicklung der Messmethode verbrachte Heinze einen Forschungsaufenthalt an der University of California, Irvine, unterstützt durch den Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ der Universität Jena. Dort lernte sie neue Radiokohlenstoff-Analysetechniken, die eine präzisere Quantifizierung mikrobieller Prozesse ermöglichen.
Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und dem Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz entstand so eine interdisziplinäre Kooperation, die neue Perspektiven für den Klimaschutz eröffnet.
Methanabbau variiert je nach Standort
Wie schnell Mikroben Methan abbauen, hängt stark von den jeweiligen Bedingungen ab. Der sogenannte Methanumsatz – also die Zeit, die Mikroben benötigen, um das vorhandene Methan vollständig zu oxidieren – reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahrzehnten.
„Während an vielen Standorten Methan vermutlich vollständig durch Mikroben abgebaut wird, könnten Regionen mit besonders hohen Methankonzentrationen, etwa in Norddeutschland, weiterhin bedeutende Quellen für Emissionen aus Feuchtgebieten oder Flüssen sein“, so Susan Trumbore, Direktorin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie.
Diese Ergebnisse zeigen, wie komplex und dynamisch die Wechselwirkungen zwischen Grundwasser, Böden und Atmosphäre sind.
Globale Bedeutung für den Klimaschutz
Die Forschenden kombinierten ihre Messdaten mit weltweiten Studien und schätzten, dass methanoxidierende Mikroben jährlich zwischen 167 und 778 Teragramm Methan abbauen. Das entspricht etwa zwei Dritteln der gesamten Methanproduktion im Grundwasser weltweit.
Zum Vergleich: Binnengewässer und Feuchtgebiete emittieren zusammen jährlich rund 164 bis 329 Teragramm Methan. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Mikroben im Untergrund eine zentrale Rolle im globalen Methankreislauf spielen – und damit auch für den Klimaschutz von großer Bedeutung sind.

Schutz des Grundwassers als Klimastrategie
Neben ihrer klimaschützenden Funktion hat die mikrobielle Methanoxidation auch Relevanz für die Trinkwasserqualität. Hohe Methankonzentrationen können Risiken für Aquifere darstellen. „Unsere Methode kann helfen, potenzielle Gefahren auch in vermeintlich sicheren Grundwasserzonen zu erkennen“, betont Kirsten Küsel, Sprecherin des Exzellenzclusters Balance of the Microverse an der Universität Jena.
Die Ergebnisse unterstreichen die Dringlichkeit eines nachhaltigen Grundwassermanagements – nicht nur für sauberes Trinkwasser, sondern auch als Beitrag zur globalen Methanreduktion.
Forschung im Rahmen von AquaDiva
Die Studie entstand im Kontext des Sonderforschungsbereichs AquaDiva, der von Kirsten Küsel, Susan Trumbore und Kai Totsche geleitet wird. Dieses Forschungsprojekt untersucht die Verbindungen zwischen Oberflächen- und Untergrundökosystemen und deren Reaktionen auf Umweltveränderungen.
Durch die Zusammenarbeit von Expertinnen und Experten aus Biogeochemie, Hydrogeologie und Mikrobiologie will AquaDiva die Widerstandsfähigkeit von Grundwasserökosystemen gegenüber dem Klimawandel besser verstehen – und Wege finden, sie langfristig zu schützen.
Hashtags
#Methanfilter #Grundwasserforschung #KlimaschutzJena #Methanabbau #Mikrobenforschung #MaxPlanckJena #UniJena #PNASStudie #AquaDiva #BalanceOfTheMicroverse
Info, UNI Jena | Foto, Falko Gutmann | Veranstaltungen im Eventkalender