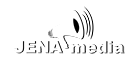Der Anfang vom Ende: Wie der Anus in der Evolution entstand
Neue Einsichten aus Jena: Der evolutionäre Ursprung des Anus
Eine zentrale Frage der Evolutionsbiologie lautet: Wann und wie entstand die hintere Öffnung unseres Verdauungstrakts – der Anus – erstmals in der Tierwelt? Ein Forscherteam um Prof. Dr. Andreas Hejnol von der Friedrich-Schiller-Universität Jena liefert jetzt eine klare Antwort: Die ersten Hinweise auf eine echte hintere Öffnung finden sich bereits bei winzigen Meereswürmern der Tiergruppe Xenacoelomorpha, die vor etwa 550 Millionen Jahren existierten. Die Ergebnisse sind in Nature Ecology & Evolution publiziert und eröffnen ein neues Kapitel zum Verständnis, wie komplexe Verdauungssysteme und damit letztlich große, energieintensive Tiere wie Säugetiere entstehen konnten.
- Ernst-Abbe-Hochschule Jena beim StartTH Together 2025
- Jenaer Big Band Ball 2026: Swing, Salsa und spektakuläre Tanzshow im Volkshaus
- Das Bebauungsplanverfahren für das Wohn- und Geschäftsquartier Friedrich-Zucker-Straße in Jena ist vorerst ausgesetzt
Warum der Anus so bedeutend ist
Die Entstehung eines durchgehenden Verdauungstrakts mit getrennten Ein- und Ausgängen war ein evolutionärer Quantensprung. Nur durch die Arbeitsteilung innerhalb des Darms – verschiedene Abschnitte mit unterschiedlicher Umgebung und Funktion – lässt sich Nahrung effizient in verwertbare Nährstoffe zerlegen. Diese Effizienz war eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Tiere größer werden konnten und komplexe, energiehungrige Organe wie das menschliche Gehirn entstehen konnten. Ohne eine spezialisierte hintere Öffnung wäre diese Arbeitsteilung nicht möglich gewesen.
Die Protagonisten: Xenacoelomorpha und ihre überraschende Rolle
Die Xenacoelomorpha sind winzige, oft reiskorngroße Meeresbewohner, die meist am Meeresboden leben. Obwohl sie äußerlich schlicht erscheinen – viele Arten besitzen lediglich eine einzige Öffnung – nehmen sie eine besondere Stellung im Tierstammbaum ein: Sie gehören zu den frühen Bilateria, also Tieren mit rechter und linker Körperhälfte, wie auch wir Menschen. Diese phylogenetische Position macht sie zu einem wertvollen Modell, um frühe evolutionäre Schritte zu rekonstruieren.

Genetische Belege: dieselben Gene für After und Spermienkanal
Bereits frühere Arbeiten aus Hejnols Gruppe hatten gezeigt, dass die Bildung der Mundöffnung bei Mensch und Xenacoelomorpha auf ähnlichen Genmustern beruht. Die aktuelle Studie ging nun der Frage nach, ob auch die genetische Grundlage für eine hintere Öffnung vergleichbar ist – und fand überzeugende Parallelen. Bei vielen erwachsenen Xenacoelomorpha bildet sich hinten eine Struktur namens Gonoporus, ein Kanal zur Abgabe von Spermien. An diesem Gonoporus fanden die Forschenden mehrere Gene, die bei anderen Tieren für die Entwicklung des Enddarms und des Anus verantwortlich sind.
JenaMedia-Veranstaltungstipp:
Sound of the 80’s Devote Jena 17.01.2026 M-Pire Music Club

Ein besonders starkes Argument lieferte ein natürlicher „Versuchsaufbau“ in Form des Pantherwurms: Dort lokalisiert sich der Gonoporus ungewöhnlich nahe am Vorderende des Körpers – und trotzdem sind dieselben After-Gene aktiv. Bei juvenilen, noch nicht geschlechtsreifen Tieren fehlen diese Expressionsmuster, sodass die Aktivität klar mit dem Gonoporus als Organ verknüpft ist. Diese Befunde deuten darauf hin, dass der Gonoporus homolog mit dem evolutiven Vorläufer des Afters ist.
Von Gonoporus zur Kloake und zum getrennten After
Wie genau sich aus einem Spermienkanal ein spezialisierter After entwickelte, lässt sich noch nicht bis auf den Tag genau rekonstruieren. Die Befunde legen jedoch nahe, dass frühe Körperöffnungen mehrfach genutzt wurden – etwa für Verdauung und Fortpflanzung zugleich, ähnlich der heute vorhandenen Kloake bei Vögeln oder Schnabeltieren. In späteren Evolutionsschritten trennten sich die Funktionen, der Darm verlängerte sich und differenzierte sich, und der Gonoporus wandelte sich zum eigenständigen Anus. Bemerkenswert: Auch beim Menschen teilen sich Genitalien und After im Embryo zunächst eine Öffnung, was die evolutionäre Verbindung zwischen Fortpflanzungs- und Verdauungsapparat widerspiegelt.

Bedeutung für die Evolutionsforschung und Ausblick
Die Entdeckung, dass schon die frühen Bilateria eine spezialisierte hintere Öffnung besaßen beziehungsweise deren genetische Grundlage nutzten, ist ein Meilenstein. Sie erklärt einen fundamentalen Entwicklungsschritt, der Bedingungen für größere Körpergrößen und komplexe Organe schuf. Für die Evolutionsbiologie heißt das: Schlüsselinnovationen wie der Anus lassen sich nicht nur morphologisch, sondern auch genetisch über weite Zeiten zurückverfolgen.
Zukünftige Studien werden versuchen, die Details der Umwandlungsprozesse zwischen Gonoporus, Kloake und separatem Anus besser zu verstehen und die zugrundeliegenden genetischen Netzwerke feiner aufzulösen. Diese Arbeiten liefern nicht nur Antworten auf klassische Fragen der Morphogenese, sondern tragen auch dazu bei, die evolutive Entstehung unserer eigenen Anatomie noch klarer zu zeichnen.
Hashtags:
#Evolution #AnusUrsprung #Xenacoelomorpha #AndreasHejnol #ForschungJena #VerdauungsEvolution #NatureEcologyEvolution #Embryologie #Evolutionsbiologie #Wissenschaft
Info, UNI Jena | Foto, Nicole Nerger // UNI Jena | Veranstaltungen im Eventkalender