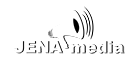Klang der Stolpersteine 2025: Ein klares Zeichen gegen das Vergessen
Am Gedenktag der Reichspogromnacht fand in Jena erneut die Aktion „Klang der Stolpersteine“ statt. Angehörige der Friedrich-Schiller-Universität Jena beteiligten sich aktiv an den Veranstaltungen, die in der gesamten Stadt an den Stolpersteinen des Kölner Künstlers Gunter Demnig als Orte des Erinnerns und Mahnens haltmachen. In diesem Jahr markierte die Initiative ein Novum: Erstmals richtete sich ein besonderer Blick auch auf Täterorte in Jena – Orte, an denen Menschen entrechtet, verfolgt oder Entscheidungen organisiert wurden, die zu Verbrechen führten.
Gesunde Arbeit 2025: Ernst-Abbe-Hochschule Jena zeigt Wege

Stolpersteine als Orte des Gedenkens – und neuer Blick auf Täterorte
Die Stolpersteine sind seit 1996 sichtbare Erinnerungen an Menschen, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Am 9. November versammelten sich Bürgerinnen und Bürger, Studierende und Hochschulangehörige, um an diesen zumeist dezent platzierten Mahnmalen zu gedenken. Neu war 2025 die Erweiterung des Fokus: Neben Opfern sollten auch historisch belastete Orte, an denen Täter handelten oder politisch-institutionelle Entscheidungen vorbereitet wurden, in das Gedenken einbezogen werden. Damit wurde die Erinnerungskultur erweitert – von der Sichtbarkeit der Opfer hin zur kritischen Betrachtung der Orte des Unrechts.
Täterorte der Stadt: Universität und Amtsgebäude im Blick
Zu den in der diesjährigen Aktion thematisierten Täterorten zählen mehrere Gebäude in Jena, die während der NS-Zeit eine Rolle in der Verfolgungs- und Ausgrenzungspolitik spielten. Erwähnt wurden unter anderem die Kahlaische Straße 1, in der seit 1935 die „Anstalt für Menschliche Erbforschung und Rassenpolitik“ angesiedelt war, sowie die August-Bebel-Straße 4, ehemaliger Sitz des Erbgesundheitsobergerichts. Auch das Universitätshauptgebäude (Fürstengraben 1) wurde als historisch belasteter Ort genannt – hier wirkte Rektor Karl Astel, der die Universität zu einer SS-orientierten Einrichtung umgestalten wollte. Solche Erinnerungspunkte sollen nicht nur dokumentieren, sondern zur kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte anregen.

Opfer sichtbar machen: Sterilisationen und T4-Opfer
Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung war die Erinnerung an Opfergruppen, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft wenig sichtbar sind. So wies Dr. Karl Porges auf Sterilisationsmaßnahmen hin, die in der ehemaligen Frauenklinik an der Bachstraße 18 vorgenommen wurden. Er und weitere Akteurinnen und Akteure fordern, diese Form der Gewalt stärker in die lokale Gedenkkultur aufzunehmen. In einem aktuellen Sammelband mit dem Titel „NS-Eugenik-Verbrechen und ihre Folgen“ werden historische Analysen und pädagogische Impulse angeboten, darunter Biografien von Opfern der sogenannten Aktion T4 – Menschen, die als „lebensunwert“ klassifiziert und systematisch ermordet wurden.
Gesellschaftliches Engagement: Von Schülerinnen bis zur Universität
Die Aktion zeigte auch positive Beispiele bürgerschaftlichen Engagements: So verlegten drei Schülerinnen aus Stadtroda im Rahmen einer Seminarfacharbeit eine Stolperschwelle und nehmen aktiv an der lokalen Gedenkkultur teil. Solche Initiativen demonstrieren, wie junge Menschen Verantwortung übernehmen, Erinnerung neu denken und Opfern eine Stimme geben. Die Beteiligung von Lehrenden, Forschenden und Beschäftigten der Friedrich-Schiller-Universität Jena unterstreicht zusätzlich, dass Erinnerung und Wissenschaft Hand in Hand gehen können – sowohl in der Forschung als auch in der öffentlichen Bildung.
Kontroverse und Ziel: Täterbiographien beleuchten
Die Einbeziehung von Täterorten wurde kontrovers diskutiert – doch Initiatoren wie Prof. Dr. Gerhard Paulus betonen die Notwendigkeit, Täterbiographien und institutionelle Verstrickungen aufzuarbeiten. Paulus, Mitbegründer der Aktion „Klang der Stolpersteine“ 2016, sieht in der Auseinandersetzung mit Täterorten einen wichtigen Beitrag zur Prävention: Nur wer die Mechanismen von Ausgrenzung, Rassismus und ideologischer Verblendung kennt, kann sich wirksam gegen heutige rassistische und antisemitische Tendenzen stellen.

Universitätsspitze: Erinnerung als Verpflichtung für die Gegenwart
Prof. Dr. Andreas Marx, Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena, würdigte das Engagement der Universitätsangehörigen. Er betonte, dass die Auseinandersetzung mit vergangenem Unrecht zugleich eine Verpflichtung zur Gegenwart darstelle: Die Lehre aus der Geschichte müsse heute heißen, sich entschieden gegen Hass, Intoleranz und Menschenfeindlichkeit zu stellen – für ein weltoffenes Thüringen und eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft.
Fazit: Erinnerung erweitern, Verantwortung übernehmen
Der „Klang der Stolpersteine“ 2025 in Jena setzte ein klares Zeichen: Erinnerung darf nicht eindimensional bleiben. Indem Opferorte sichtbar gemacht und Täterorte kritisch beleuchtet werden, entsteht ein differenzierteres Bild der lokalen Geschichte. Die Initiative ermutigt Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Hochschulen und Institutionen, das Erinnern aktiv zu pflegen – weit über einzelne Gedenktage hinaus.
Weitere Informationen: https://klang-der-stolpersteine.de/wp/
Hashtags
#KlangDerStolpersteine #Erinnerungskultur #UniJena
Info, UNI Jena | Foto, Frank Liebold, Jenafotografx | Veranstaltungen im Eventkalender