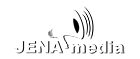Seit sechs Wochen sind die Schulen wegen der anhaltenden Corona-Krise bundesweit geschlossen. Das stellt Lehrerinnen und Lehrer vor große Herausforderungen. Wenn der Unterricht nicht mehr in Klassenzimmer in der Gemeinschaft stattfinden kann, müssen Lehrkräfte neue Wege finden, wie sie ihrem pädagogischen Auftrag gerecht werden können. In vielen Fällen bedeutet das: Digitalisierung über Nacht. Ob und wie gut das bereits gelingt und welcher Unterstützungsbedarf weiterhin besteht, das zeigen Ergebnisse einer aktuellen Studie aus Thüringen.
Dafür hat ein Forschungsteam unter Leitung von Prof. Dr. Bärbel Kracke von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und Dr. Benjamin Dreer von der Universität Erfurt Anfang April eine Online-Befragung unter rund 1.200 Thüringer Lehrkräften durchgeführt. Quer durch verschiedene Schularten und Schulamtsbereiche haben sie die Lehrerinnen und Lehrer nach Herausforderungen und Unterstützungsbedarfen in der aktuellen Situation sowie für den Neustart an den Schulen befragt.
Wie arbeiten Thüringens Lehrkräfte während der Schulschließungen?
Studie der Universitäten Jena und Erfurt stellt erste Ergebnisse vor.

Erste Ergebnisse der Studie liegen jetzt vor. Diese zeigen:
- Die Thüringer Lehrerinnen und Lehrer arbeiten in der Distanzbetreuung vorwiegend mit klassischen Arbeitsmitteln wie Büchern und Arbeitsheften sowie mit digitalen Standardmitteln (z. B. PDF und E-Mail, Angebote der Schulbuchverlage), die ihnen bereits aus der Zeit vor den Schulschließungen vertraut sind.
- Ein großer Teil der befragten Lehrerkräfte sieht die wesentlichen Herausforderung der Distanzbetreuung darin, dass besonders leistungsschwache und Schülerinnen und Schüler mit besonderen Förderbedarfen sowie mit nicht-deutscher Familiensprache aktuell wesentlich schlechter erreicht werden können und die Leistungsunterschiede in der Zeit des Distanzunterrichts zunehmen werden. Sie wünschen sich vor diesem Hintergrund Möglichkeiten, die entstandenen Defizite nach dem Neustart zu adressieren und sind außerdem mit großer Mehrheit der Auffassung, dass Eltern sowie die Abstimmung im Fachkollegium von Bedeutung für den Erfolg des Distanzlernens sind.
- Ein großer Teil der befragten Lehrerinnen und Lehrer zeigt sich der aktuellen Situation und den damit verbundenen Herausforderungen gegenüber aufgeschlossen und bereit, auch bislang unbekannte digitale Werkzeuge auszuprobieren und die eigenen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch Lehrkräfte, die sich stärker gefordert und belastet fühlen, insbesondere, wenn sie nicht über die notwendigen Voraussetzungen für die digitale Distanzbetreuung verfügen.
- Für den Neustart an den Schulen stehen nun Wünsche nach dem weiteren raschen und systematischen Ausbau der Digitalisierung an den Schulen und nach schulinternen Fortbildungen im Vordergrund. Zu klären sind dabei unmittelbare Fragen nach Prüfungen und Notenvergabe. Konkrete Unterstützung wünschen sich die Lehrkräfte im Hinblick auf die Gestaltung eines hygienischen Arbeitsablaufs und zur Infektionsvermeidung. Besonders wichtig erscheint, den Neustart so zu gestalten, dass in den Kollegien eine Aufarbeitung der Erfahrungen während der Distanzphase stattfinden kann.
„Wir sehen, dass die plötzlichen Herausforderungen von vielen Lehrkräften kreativ bewältigt wurden. Vor allem Lehrkräfte an Schulen, die vor den Schulschließungen schon eine Kultur des selbstständigen Lernens der Schülerinnen und Schüler unterstützt durch digitale Lehre praktizierten, fühlten sich beim Distanzlernen weniger belastet. Wir sehen ein großes Bedürfnis der Lehrkräfte nach systematischen Konzepten für die Digitalisierung an Schulen, die sowohl Ausstattung als auch Weiterbildung sowie den pädagogischen Umgang mit Schülern mit größeren Unterstützungsbedarfen umfassen. Aus der Studie erhalten wir auch für die Lehrerbildung an der Universität Jena wertvolle Hinweise“, erklärt Prof. Kracke.
Die Ergebnisse der Erhebung werden nun gemeinsam mit Empfehlungen an das Kultusministerium übergeben. Die Initiative ist angedockt an ein gemeinsames Projekt der Unis in Erfurt und Jena zur Digitalisierung in der Lehrerbildung, an dem auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen beteiligt ist.
Weiterführende Informationen:
Die Studie ist abrufbar unter:
https://www.uni-jena.de/unijenamedia/Thueringer_Studie_zum_Unterricht_in_der_Coronakrise.pdf
Info, FSU JENA